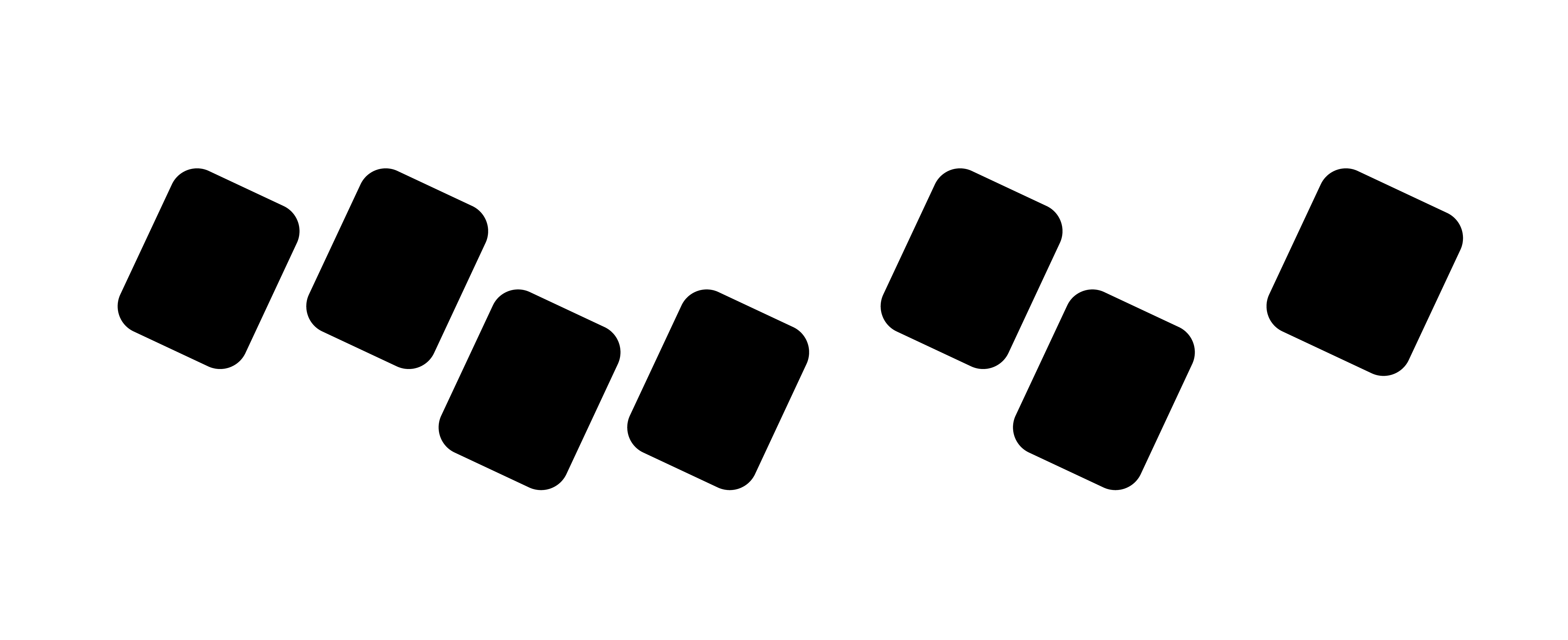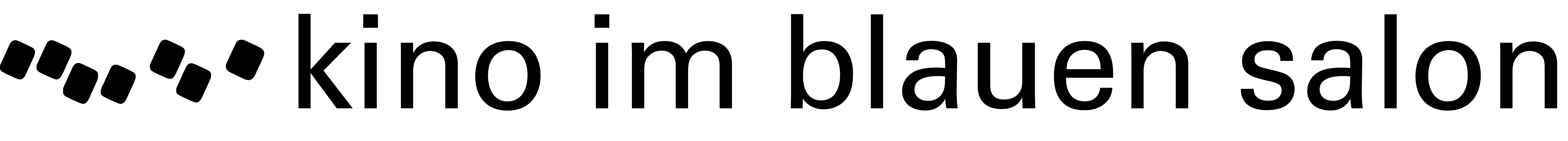Liebe 1962
Sein klagendes, beklemmendes Finale – eine Symphonie stumm lauschender Objekte an einer unscheinbaren Straßenecke Roms, bestimmt für ein Rendezvous, zu dem keiner der Liebenden erscheint – zählt zu den revolutionärsten und zu Recht gefeierten Momenten des europäischen Kinos der Jahrhundertmitte. Doch L’eclisse ist durchweg von derselben filmischen Brillanz geprägt: Antonionis Darstellung urbaner Entfremdung schreibt sich schleichend in die zum Scheitern verurteilte Affäre zwischen einer Übersetzerin (Monica Vitti) und einem Börsenmakler (Alain Delon) ein. In meisterhaft komponierten Tableaus entlarvt Antonioni die innere Leere der neureichen Gesellschaft Roms und deutet an, dass hinter der modernen Blasiertheit eine tiefere Ruhelosigkeit liegt. Vittoria scheint von der Liebe ermüdet, ihre Beziehung zu Piero bleibt oberflächlich, mehr ein Spiel als echtes Gefühl. Die letzten sieben Minuten des Films führen diese Ästhetik des Verschwindens zur Perfektion. Ein Werk stetig wachsender Unruhe, dessen seismische Erschütterung Martin Scorsese als „Fortschritt im Erzählen“ beschrieb.

Vorfilm: Gente del Po
Das untere Po-Tal: eine reiche und schöne Landschaft, eine Region, die zu den reichsten in Italien zählen könnte, in der die Menschen aber in tiefster Armut leben. Der Film wurde 1943 begonnen, jedoch erst 1947 fertiggestellt und gilt als einer der ersten neorealistischen Filme. Verbunden mit seiner Heimatregion, dreht Antonioni dort seinen ersten Film und lässt seine Kamera entlang des nebelverhangenen Po schweifen. Mit einem scharfen Blick für Details fängt er die Stille und Langsamkeit ein, zeigt das Leben in verlassenen Hütten und auf maroden Booten. Ein schwebender Dokumentarfilm – und die Geburt eines Regisseurs.